Ein Rückblick auf die Kartage: Am Gründonnertag werden nach den liturgischen Gesetzen der römischen Kirche in den Domkirchen während eines eigenen Hochamtes am Morgen die heiligen Öle vom Bischof feierlich geweiht, nämlich das Krankenöl (oleum infirmorum), der Chrisam (sanctum chrisma) und das Katechumenenöl (oleum catechumenorum).
Seit der Liturgiereform ist der Ritus der Ölweihe nach den vorkonziliaren liturgischen Büchern im Bereich des Römischen Ritus unterdrückt worden und de facto verschwunden. Erzbischof Marcel Lefebvre (1905-1991) hatte, indem er an dem festhielt, was er empfangen hatte, sich berechtigt gefühlt, diese heilige Pontifikalhandlung mit ihren heiligen Riten am Gründonnerstag durchzuführen, auch wenn ihm nicht mehr die Autorität und das Amt eines Diözesanoberhirten zukam.
Die Fortführung der überlieferten Liturgie und der heiligen Riten ist ohne die Weihe der heiligen Öle nach dem alten Pontifikale nicht schlüssig. Gott sei es geklagt, daß über viele Jahre Erzbischof Marcel Lefebvre der einzige Prälat des lateinischen Ritus war, der diese geheimnis- und bedeutungsvollen Zeremonien gemäß dem vorkonziliaren Pontifkale vollzogen hat.
Dieser heiligen Pflicht als Apostelnachfolger, den Gläubigen die heiligen und notwendigen Öle für die Sakramente und Sakramentalien im überlieferten Ritus zu bereiten, sind die von ihm konsekrierten Weihbischöfe in all den Jahren auch nachgekommen. Die geeigneten Orte dafür sind wegen der großen Zahl dafür notwendigen Kleriker die Priesterseminare der Bruderschaft.
In diesem Jahr 2023 konnte wieder eine Ölweihmesse im Internationalen Priesterseminar Herz Jesu im bayerischen Zaitzkofen feierlich zelebriert werden. Der zelebrierende Prälat war auf Bitten des Generaloberen Bischof Vitus Huonder, der seit seiner Emeritierung im Institut Sancta Maria in Wangs seine Wohnung genommen hat. Msgr. Huonder war umgeben von zwölf Priestern, sieben Diakonen und sieben Subdiakonen.
Die Gläubigen waren aufgerufen, sich an diesem Gründonnerstagmorgen mit ihren Gebeten mit dieser für die Auferbauung des mystischen Leibes so wichtigen Zeremonie zu verbinden.
Die heiligen Öle wurden nach der Zeremonie von den an der pontifikalen Ölweihmesse teilnehmenden Priestern in die Priorate und Kapellen gebracht, wo sie schon in der Osternacht bei der Weihe des Taufwassers gebraucht wurden.
Die Aufbewahrungsgefäße für die heiligen Öle sind oft mit Abkürzungen beschriftet, mit „S.C“ für das heilige Chrisma, „O.C“. für das Katechumenenöl und „O.I.“ für das Krankenöl.
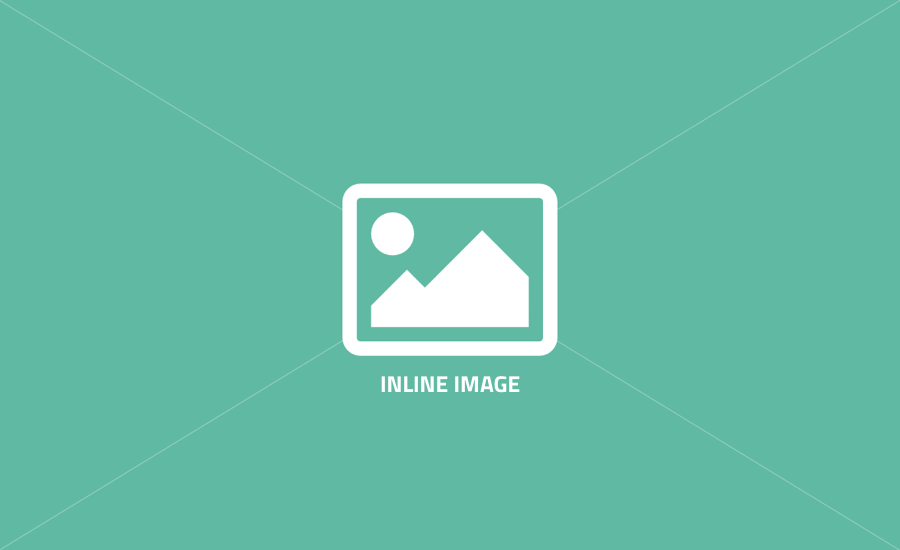
Das Krankenöl ist reines Olivenöl und wird gebraucht beim Sakrament der Letzen Ölung und (mit Chrisam vermischt) bei der Glockenweihe.
Der Chrisam wird aus Olivenöl und Balsam gemischt. Er wird vor allem beim heiligen Sakrament der Firmung verwendet, aber auch bei der heiligen Taufe, bei der Weihe des Taufwassers in der Osternacht, bei der heiligen Priesterweihe und der Konsekration eines Bischofs, bei der Weihe der Patenen, Kelche, Altäre, Glocken und Kirchen. Mit diesem heiligen Öl gesalbt, wird der Gläubige in sichtbarer Weise ein Glied des Gottmenschen, dessen Name „Christus“ die Salbung anzeigt, die der Messias als König und höchster Priester erhalten hat. Mit diesem königlichen Öl wird ebenso angedeutet, dass der Christ an der königlichen Würde Christi Anteil hat.
Das Katechumenenöl ist ebenfalls reines Olivenöl. Es hat keine sakramentale Bedeutung, aber sein Gebrauch stammt schon aus apostolischen Zeiten. Es wird gebraucht bei der heiligen Taufe, bei der Weihe des Taufwassers in der Osternacht und bei der Konsekration von Kirchen und Altären. Auch bei der Priesterweihe wird es angewendet, um die Hände zu salben, ebenso zur Salbung der Könige und Königinnen.
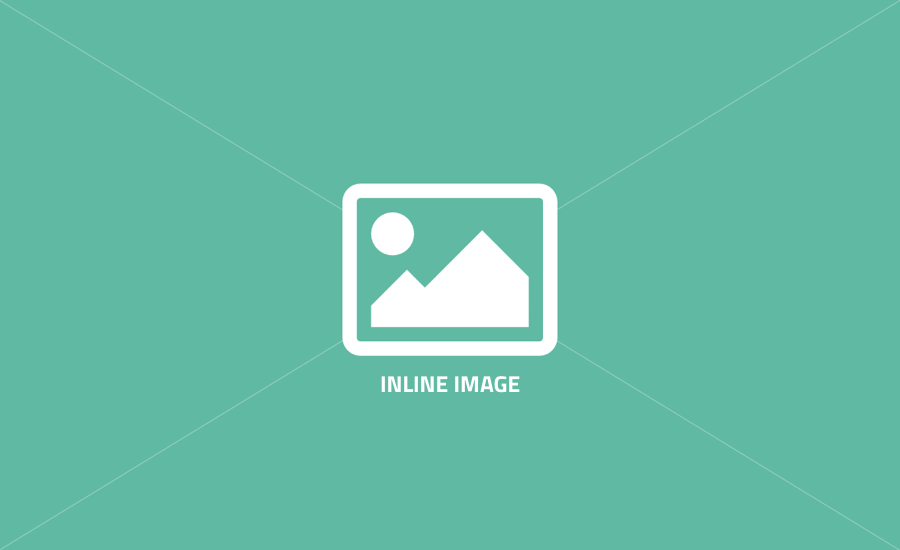
Der Glaube lehrt uns, dass, wenn das Wasser unsere Wiedergeburt erwirkt, wir durch das heilige Öl gefestigt und gestärkt werden. So ist das Öl eines der vorzüglichsten Elemente, deren sich der göttliche Urheber der Sakramente bediente, um die Gnade in unseren Seelen sowohl zu bezeichnen als auch zu bewirken.
Die heiligen Salbungen, die durch die bischöfliche Ölweihe ermöglicht werden, gehören zum sakramentalen Leben des Christen, von der ersten Ölung bei der Taufe bis zur letzten Ölung am Ende der irdischen Pilgerschaft.
Die Weihezeremonie, in der die Priester als Zeugen und Mitarbeiter des Bischofs handeln, bezeichnet die Einheit des katholischen Priestertums. Die heutigen Umstände sind für uns Katholiken, die die Spannungen der Kirchenkrise nicht verursacht haben, eine Quelle von großer Traurigkeit über den Zustand des kirchlichen Lebens.
Die Weihe der Öle ist von hoher Symbolik und es erinnert an das sakramentale Band, das Bischof, Priester und Gläubige miteinander verbindet „mit allen, die Sorge tragen für den rechten, katholischen und apostolischen Glauben.“ Die Zeremonie ist aber auch ein Bekenntnis zur Tradition, zum Ritus und zum Glauben, den uns die Mutter Kirche übermittelt.
Das von den Benediktinern von Maria Laach herausgegebene vorkonziliare Volksmessbuch beschreibt die Ölweihmesse mit folgenden Worten:
«Diese heiligen Öle haben also eine große Bedeutung im sakramentalen Leben der Kirche. Sie heilen, heiligen und stärken die Gläubigen als die Glieder Christi. Vor allem der heilige Chrisam als das eigentliche Öl der Weihe, aber auch die anderen heiligen Öle sind ein Bild der göttlichen Salbung, die dem „Haupte“, nämlich Christus selbst, zu eigen ist, dessen menschliche Natur von der Gottheit gleichsam „gesalbt“ ist, und der daher auch der „Christus“, d.i. der Gottgesalbte, heißt. Diese geistige Salbung geht auf die Glieder des „Leibes“ in den Sakramenten über, d.h. auch sie werden durchdrungen vom Heiligen Geiste, der sie zu Bildern Christi und dadurch zu Kindern Gottes macht.
Die Weihe der heiligen Öle, besonders die des Chrisams, wird mit großer Feierlichkeit und Pracht vollzogen. Der Bischof ist umgeben von zwölf Priestern in weißem Messgewand, von sieben Diakonen und sieben Subdiakonen in den weißen Gewändern ihrer Ordnung. Die zwölf Priester stellen die zwölf Apostel dar, von denen Jesus Christus, der ewige Hohepriester, umgeben war. Die sieben Diakone entsprechen der Zahl, welche von den Aposteln aufgestellt wurde, und die Zahl der Subdiakone ist ihr nachgebildet. Auch die besondere stadtrömische Überlieferung spiegelt sich in dieser Zahlenordnung wider. Während Diakone und Subdiakone bei der Ölweihe nur Diener und Zeugen sind, sind die zwölf Priester Diener und Mitwirkende. Dass die Ölweihe gerade am Gründonnerstag stattfindet, hat seinen Grund darin, dass die heiligen Öle bei der Spendung der heiligen Taufe und Firmung in der Osternacht notwendig waren. Und da nach uralter kirchlicher Sitte wichtigere Segnungen nur innerhalb des heiligen Messopfers vorgenommen wurden, so war der Hohe Donnerstag als der letzte Tag vor Ostern, an dem eine Messfeier stattfand, von selbst dafür empfohlen.
Die Gesänge und Lesungen der Weihemesse weisen mit Worten der Heiligen Schrift auf die vielfache Bedeutung der heiligen Öle hin.
Der Einzugsvers (Introitus) erinnert an die Priesterweihe, deren erster Träger Christus ist, dessen priesterliche Salbung aber das ganze Volk Gottes mitheiligt und ihm nächst dem amtlichen Priestertum ein allgemeines Priestertum mitteilt, durch das es Gott gehört und ihm zu opfern fähig ist.
Es wird, wie das Tagesgebet (Oration), zu einem „geheiligten Volke“.
Die Lesung (Lectio) gedenkt der Krankenölung, und der folgende Zwischengesang (Graduale) dankt Gott für die Gabe der Stärkung und Tröstung.
Das Evangelium berichtet, wie die zwölf Apostel mit Vollmacht ausgesandt wurden und Kranke durch die Salbung heilten.
Zu Beginn der Opferfeier erinnert der Opferungsvers (Offertorium) wieder an die göttliche Salbung des Hauptes Christi, in deren Kraft auch wir mit Freude unsere Gaben bringen.
In der Präfation aber bittet der Bischof Gott um die Salbungsgnade für alle Getauften, die durch sie an der königlichen, priesterlichen und prophetischen Würde Christi Anteil erhalten und zu Tempeln Gottes geweiht werden.
Nach der Kommunion des Bischofs werden Chrisam und Katechumenenöl geweiht und dann als Kommunionvers der letzte Vers des Evangeliums wiederholt; er bestärkt den Bischof in seinem Auftrag und in seiner Vollmacht als Nachfolger der Apostel.»