Italienische Kongregation Maria Schnee
Geschichte der Minoritenkirche
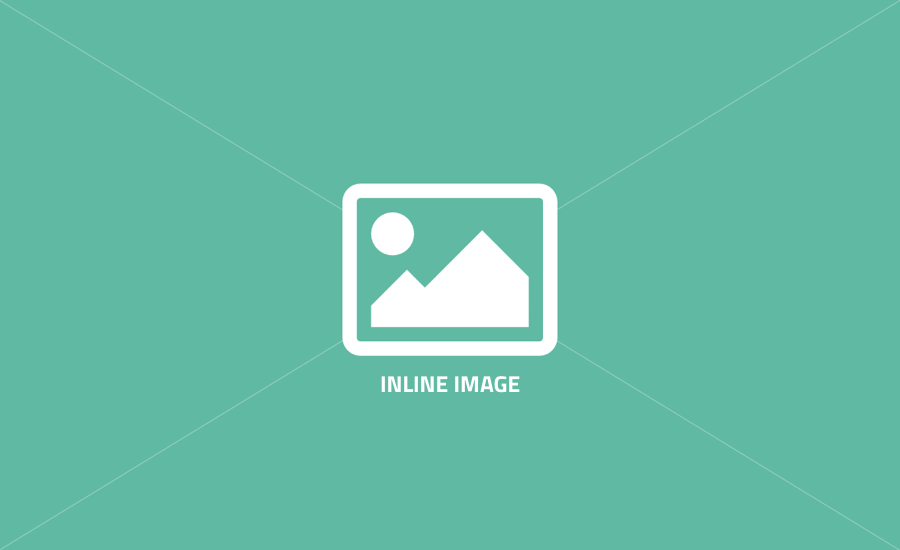
Die Minoritenkirche in Wien ist eine der ältesten und künstlerisch wertvollsten Kirchen der Stadt. Es erstaunt daher nicht, dass sie auch eine sehr bewegte Geschichte erlebte.
Der Minoritenpater Barnabas Strasser erzählt in seiner Chronik, dass der Babenbergerherzog Leopold VI. bei seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land 1219 in Assisi den hl. Franziskus um die Entsendung einiger Brüder nach Wien gebeten habe, was dann um 1224 erfolgt sei.
Hier schenkte man ihnen ein Grundstück mit einem der hl. Katharina von Alexandrien geweihten Kirchlein vor den Mauern der Stadt, zwischen dem Schottenkloster und der herzoglichen Residenz. Unverzüglich begannen die Fratres mit dem Bau eines Klosters, das 1234 urkundlich erwähnt wird. Von dem ursprünglichen romanischen Baubestand ist nichts erhalten geblieben. Besonders der große Brand des Jahres 1276 hat große Teile des Konvents eingeäschert.
Bau der Minoritenkirche
Das starke Anwachsen der nunmehr in Wien lebenden Minoriten – schon bald gab es mehr als hundert Priestermönche – machte einen Neubau von Kirche und Kloster notwendig. Schon 1276 legte König Ottokar II. Premysl den Grundstein zum Neubau jenes Gotteshauses, das nun bereits auf dem heutigen Standort der Kirche entstand, außerdem versprach der Monarch Steuerfreiheit für alle, die zum Bau der Kirche beigetragen hatten.
Durch den Schlachtentod Ottokars 1278 auf dem Marchfeld verzögerte sich der Bau, der erst nach der Jahrhundertwende abgeschlossen werden konnte und dem Heiligen Kreuz geweiht wurde.
Dieses neu errichtete Gotteshaus erhielt die Gestalt eines zweischiffigen Langhauses mit zweijochigem Langchor (Presbyterium), der mit den fünf Seiten eines Zehnecks schloss. Dieser Langchor, den man 1785/86 in ein fünfstöckiges Wohnhaus umbaute, wurde 1903 abgebrochen. Im Zusammenhang mit dem U-Bahn-Bau (1984-86) legte man die Grundmauern des ehemaligen Langchores frei.
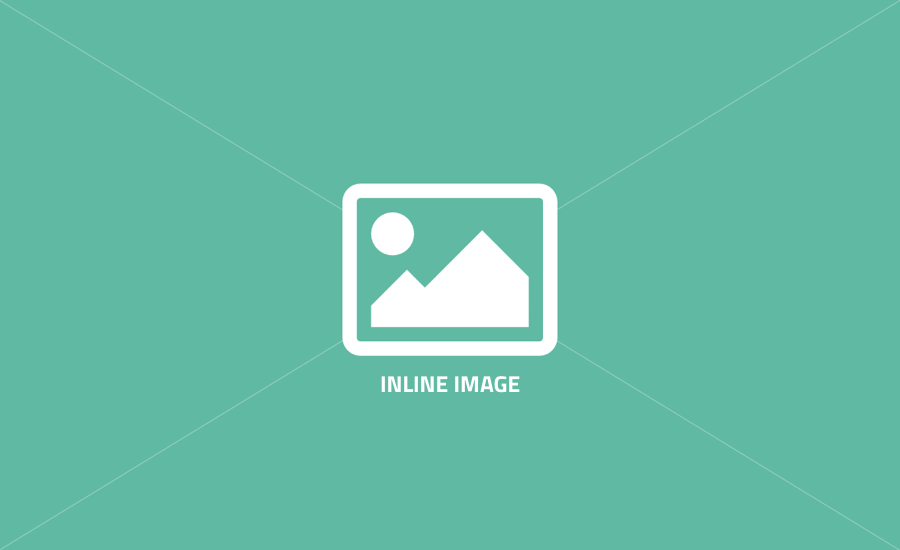
Bedeutende Veränderungen gab es unter den ersten Habsburger-Herrschern Österreichs. Blanche von Valois († 1305), Gemahlin Herzog Rudolfs III. und Tochter Philipps III. von Frankreich, verfügte 1304 testamentarisch den Bau einer Kapelle zu Ehren ihres Großvaters, des 1297 heiliggesprochenen Königs Ludwig IX. Die 1328 verwirklichte Ludwigskapelle war zuerst ein selbständiger Anbau im NO des zweischiffigen Langhauses der Minoritenkirche, wurde später in das Langhaus integriert (heute: Nordschiff mit Antoniuskapelle). Ab 1339 entstand so die heutige dreischiffige Halle, bestehend aus dem ursprünglichen Langhaus und der Ludwigskapelle.
Außerdem baute man eine neue West-Fassade, wobei besonders das Mittelportal – u. a. auch mit Gewändefiguren – prunkvoll nach dem Vorbild französischer Spätgotik ausgestaltet wurde. Im Nekrolog der Minoriten wird Bruder Jakob von Paris († um 1340), der Beichtvater Albrechts II., als Schöpfer dieses Kunstwerks bezeichnet.
Da der Herzog und seine Gemahlin Johanna von Pfirt ganz offensichtlich wesentlich zur Entstehung der für Wien zweifellos einzigartigen spätgotischen kathedralartigenen Dreierportalgruppe beigetragen haben, findet sich auch eine Darstellung Albrechts II. und seiner Gattin im Mittelportal neben dem Kreuz Christi.
Für eine Mendikantenkirche ist diese reiche Ausstattung – zusammen mit den beiden – ebenfalls nach französischen Vorbildern (vgl. Kathedrale Notre-Dame in Paris) zwischen 1350 und 1370 ausgeführten prächtigen Fensterrosen (mit „strahlendem“ sowie „rotierendem“ Maßwerk) an der Südwand – ohne Zweifel ungewöhnlich.
1350-60 oder etwas später wurde schließlich der heute nur mehr teilweise erhaltene Glockenturm gebaut (als Baumeister ist ein Laienbruder Nikolaus genannt). Seine Bekrönung musste wegen Beschädigungen – v. a. während der Türkenkriege – mehrmals erneuert werden und wurde schließlich abgetragen. Darauf brachte man jenes niedrige zugespitzte Ziegeldach an, das noch heute besteht.
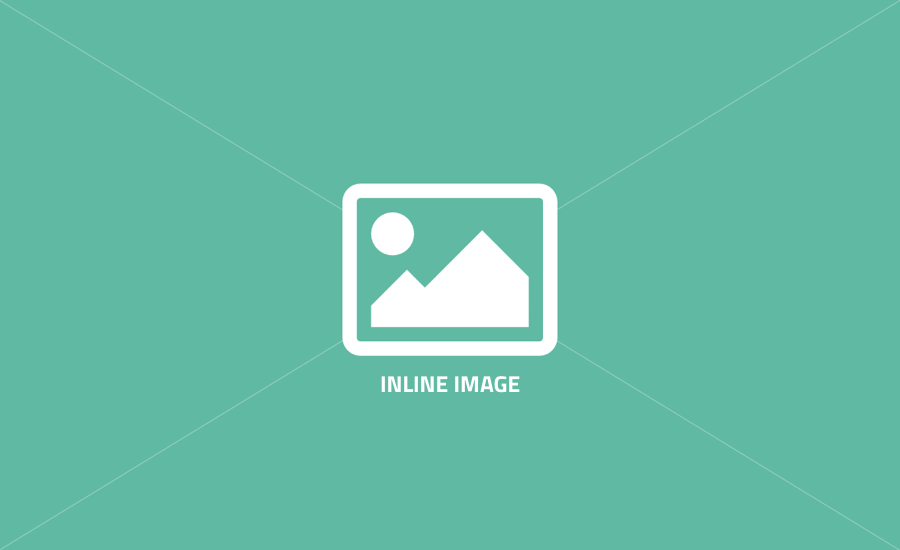
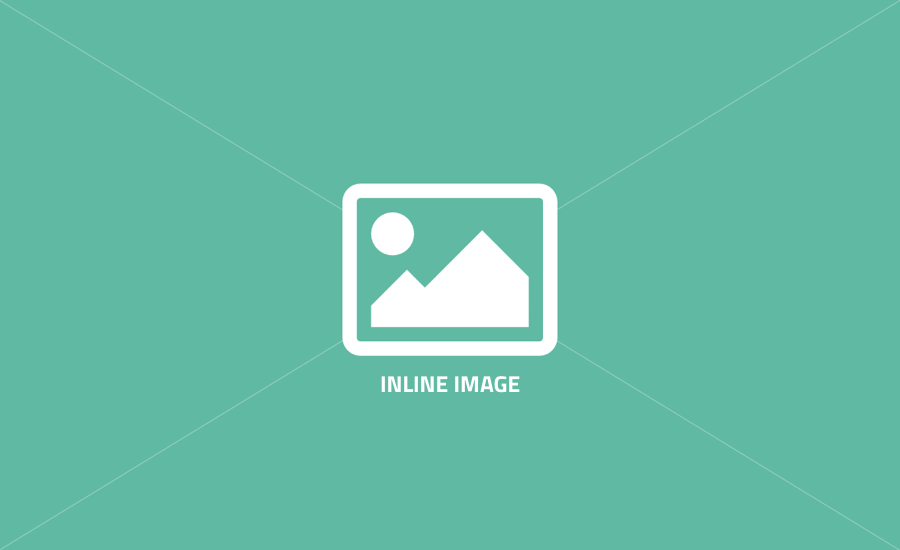
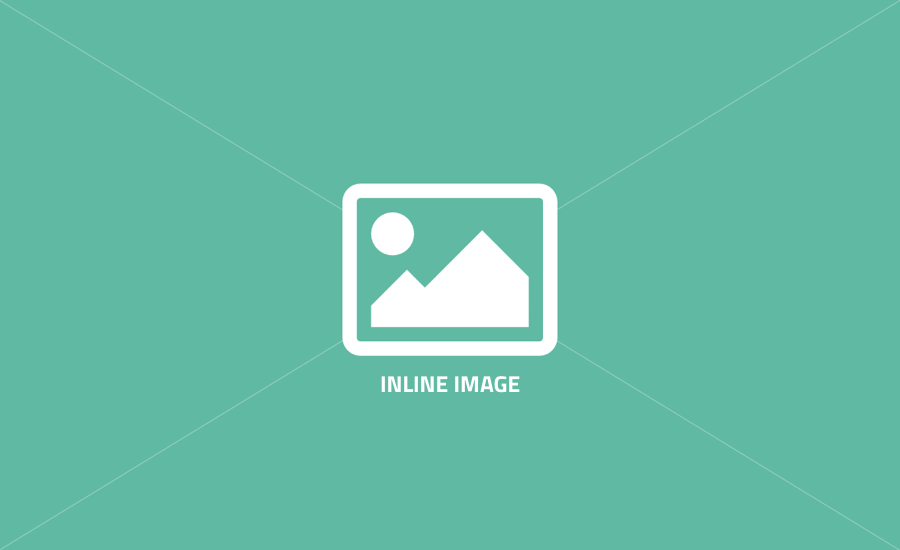
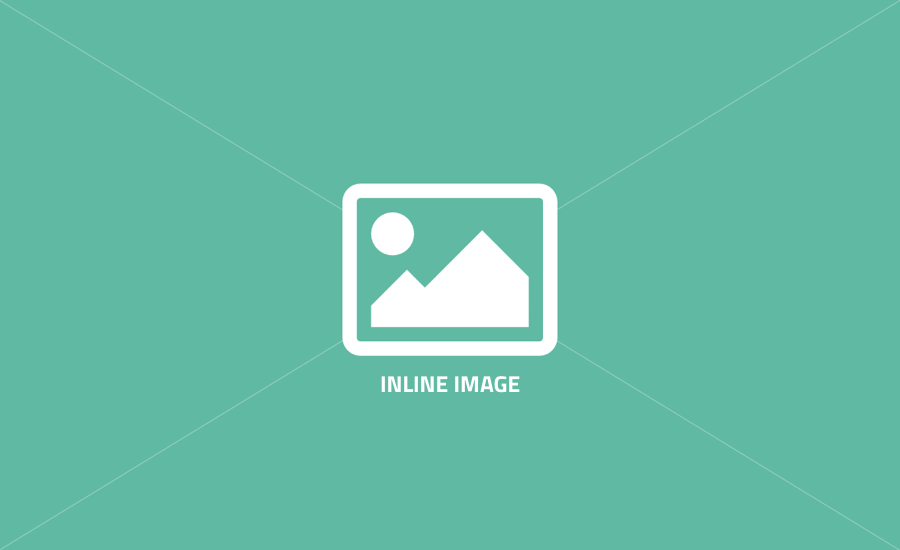
Reformationswirren
In den Reformationswirren wurde die Minoriten von 1569 bis 1620 von den Protestanten okkupiert, wobei den Minoriten die Zelebration der hl. Messe gestattet wurde.
Immer mehr entwickelten sich die Kapellen in der Minoritenkirche, v. a. die Ludwigskapelle, sowie der Friedhof, zu Grabstätten des Adels. Neben Blanca von Valois und Isabella von Aragon wurde auch Margarete von Tirol, die letzte Landesfürstin Tirols, genannt Maultasch (gestorben 1369), hier begraben, ebenso wie Angehörige der Lichtensteiner, Dietrichsteiner, Puchaimer, Hojos, Stauffenberger, Greifensteiner; Piccolomini, Medici, Cavalcanti, Montaldi, Valperga, etc.
Außerdem muss erwähnt werden, dass die Minoriten schon seit dem Ende des 14. Jhdts. lebhaften Anteil am Lehramt der Wiener Universität nahmen, besonders natürlich in den Fächern der Theologie, aber auch der Jurisprudenz.
Zu Beginn des 18. Jhdts. lebte im Wiener Konvent auch der venezianische Kosmograph Br. Vincenzo Coronelli, den Kaiser Karl VI. zum Leiter der Donauregulierung ernannte und dessen berühmte Globen sich heute in der Globensammlung der Wiener Nationalbibliothek befinden.
Italienische Nationalkirche
Einschneidende Veränderungen für die Minoritenkirche brachte die zweite Hälfte des 18. Jhdts. Eingeleitet wurde diese Entwicklung dadurch, dass die in Wien eingebürgerten Italiener im Jahre 1625/26 unter der Leitung des Wilhelm Lamormaini, Jesuitenpater und Professor an der Wiener Universität, eine italienische Kongregation gründeten, die ihre Gottesdienste zunächst in einer Jesuitenkapelle, später in der Katharinenkapelle bei der Minoritenkirche feierten, die nach einer gründlichen Restaurierung in Erinnerung an „Santa Maria Maggiore“ zu Rom auf den Namen „Madonna della Neve“ eingeweiht wurde.
1783 versetzte Kaiser Joseph II. die Minoriten in das vormalige Trinitarierkloster auf der Alser Strasse, und die Minoritenkirche wurde mit der Begründung, dass die Kapelle „S. Maria della Neve“ für die etwa 7000 in Wien lebenden Italiener zu klein sei, der Congregazione italiana mit der Auflage übertragen, dass die Gemeinschaft nun auch die große Kirche zu restaurieren habe (kaiserliches Dekret vom 3. Juni 1784).
Die reich geschmückte Kapelle „Madonna della Neve“ ging in kaiserlichen Besitz über und wurde schließlich um 1900 abgebrochen. Auch das Minoritenkloster ging in den Staatsbesitz über; man verwendete es für kaiserliche und ständische Kanzleien.
Unter größten finanziellen Belastungen führte nun die Kongregation den kaiserlichen Auftrag der Kirchenerneuerung aus, wobei die gründliche Instandsetzung des Gotteshauses dem Hofarchitekten Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg anvertraut war (1784-1789). Um die Baukosten einigermaßen abdecken zu können, wurden der alte Langchor (Presbyterium) sowie die zu Beginn des 14. Jhdts. am westlichen Ende der Südseite des Langhauses angebaute (und heute nicht mehr existierende) Johanneskapelle in Wohnhäuser umgewandelt.
Die feierliche Einweihung der Kirche unter dem Namen „Madonna della Neve“ fand am 16. April 1786, am Ostersonntag, statt.
Nachbildung des berühmten Wandfreskos von Leonardo da Vinci „Das letzte Abendmahl Jesu Christi“.
Anfang des 19. Jhdts. kam auch eine Mosaikkopie von Leonardo da Vincis Letztem Abendmahl in die Kirche. Sie war von Napoleon bei Giacomo Raffaelli in Auftrag gegeben worden, wurde aber wie einige andere Kunstwerke erst nach seinem Sturz beendet und wurde von seinem Schwiegervater Kaiser Franz I. gekauft. Für seinen ursprünglich vorgesehenen Aufstellungsort im Belvedere erwies sie sich als zu groß, so dass sie letztlich in diese Kirche kam.
Nach 1900 fanden die letzten Veränderungen statt, insbesondere der Anbau des chorähnlichen Sakristeihauses im Osten (anstelle des Langchores) und des Arkadenganges im Süden der Kirche.